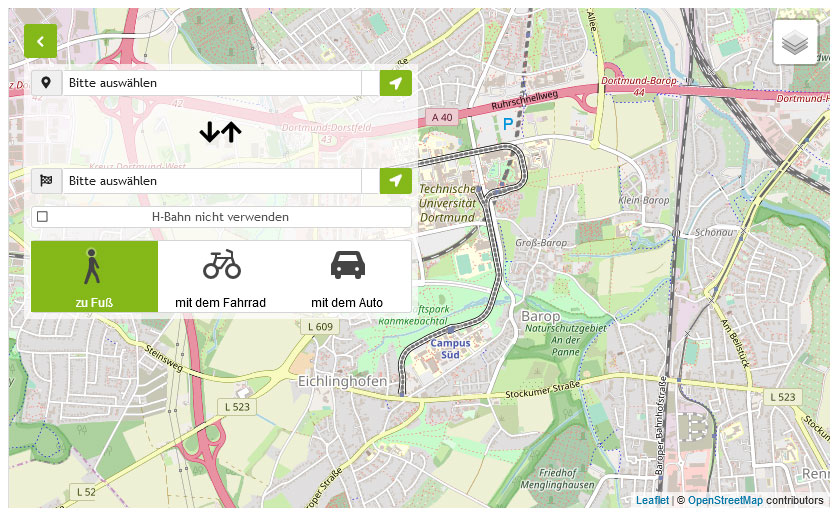Fortgeschrittenen-Projekt (F-Projekt)
Im F-Projekt lernen die Studierenden, komplexe raumbezogene Problemstellungen mit sozial- und ingenieurwissenschaftlichen Mitteln und in kooperativer Weise innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens zu bearbeiten und dabei Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die Themen der Projekte orientieren sich an jeweils aktuellen Fragestellungen und Themen des Lehrstuhls und eröffnen Kooperationsmöglichkeiten mit der Praxis.
Veranstaltungen im WiSe 2025/26
F05 - Strategien für die Wasserstofftransition – Analyse von Innovationen und Best-Practices
Link zum LSF
Abgeschlossene F-Projekte am Lehrstuhl (Auswahl)

Der voranschreitende Klimawandel lässt die Anforderungen an eine nachhaltige Energieversorgung steigen. Deutschland strebt an, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein und den Umstieg auf erneuerbare Energien zu beschleunigen, wofür die Energieversorgung grundlegend umgebaut und erweitert werden muss. Für die Umstellung auf erneuerbare Energien ist eine integrierte Zielnetzplanung für Strom-, Wärme- und Gasnetze aussichtsreich, welche bestrebt, die Sektoren systemübergreifend zu betrachten, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Insbesondere die Zielnetzplanung für Stromnetze hat in den letzten Jahren mit der Einführung von § 14d EnWG im Jahr 2022 an Bedeutung gewonnen. Dieser verpflichtet Netzbetreiber:innen von Elektrizitäts- verteilnetzen, alle zwei Jahre einen Netzausbauplan vorzulegen. Die neuen Regelungen bieten Chancen, bringen aber auch Herausforderungen mit sich, da es in Deutschland bislang wenig Erfahrung mit der Zielnetzplanung gibt.
Das Projekt befasst sich daher mit der Energienetzplanung der drei Sektoren und erforscht, was eine integrierte und zukunftsorientierte Zielnetzplanung umfassen sollte, um die Entwicklung der Energiewende nachhaltig zu fördern. Ziel der Forschung ist die Gewinnung neuer Erkenntnisse zur integrierten Zielnetzplanung gemäß § 14d EnWG sowie die Entwicklung von Ansätzen zur Integration von Strom-, Wärme- und Gasnetzen in eine ganzheitliche, sektorenübergreifende Planung.
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden verschiedene Expert:innen-interviews mit an der Energienetzplanung beteiligten Akteur:innen durchgeführt, um ein genaueres Verständnis über deren Aufgaben zu erlangen und Interaktionen untereinander besser nachvollziehen zu können. Ergänzend dazu wurde eine Umfrage mit Kommunen in ganz Deutschland zum Stand der Zusammenarbeit der Akteur:innen durchgeführt. Im internationalen Vergleich sind Länder, wie unter anderem Dänemark, in der Energienetzplanung durchaus fortschrittlicher als Deutschland. Daher wurde im März eine Exkursion nach Kopenhagen durchgeführt, um durch Ortsbegehungen und Interviews zu ermitteln, ob Ansätze aus Dänemark auf Deutschland übertragbar sind. Im weiteren Verlauf wurden die gesammelten Erkenntnisse ausgewertet und die Forschungsfragen beantwortet. Abschließend wurden planerische Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Zielnetzplanung gegeben.

Der Wärmesektor ist aktuell für einen erheblichen Teil der Treibhausgasemissionen des deutschen Energiesektors verantwortlich. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der gesetzten Klimaziele zur Einsparung von Treibhausgsemissionen, hat der Bund die kommunale Wärmeplanung als neue Pflichtaufgabe für deutsche Kommunen beschlossen. Das am Anfang des Jahres in Kraft getretene „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ (Wärmeplanungsgesetz) stellt hierfür die Grundlage dar. Das Gesetz sieht den wesentlichen Ablauf wie folgt vor: Durchführung einer Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Entwicklung eines Zielszenarios und einer Umsetzungsstrategie, Akteursbeteiligung und Monitoring.
Ziel der Projektarbeit ist es, die nach dem Wärmeplanungsgesetz vorgegebenen Verfahrensschritte der kommunalen Wärmeplanung in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Kommunen Bad Bentheim und Neuenhaus durchzuführen und zu analysieren. Die beiden Kommunen stehen in diesem Zusammenhang repräsentativ für deutsche Kommunen im ländlichen Raum, da sie sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen, die sich durch die neu eingeführte Wärmeplanung ergeben haben. Da die beiden Partner-Kommunen zum Projektbeginn bereits unterschiedlich weit in der Wärmeplanung vorangeschritten waren, wurden die ersten drei Schritte für die Kommune Neuenhaus und die letzten drei Schritte für Bad Bentheim durchgeführt.
Um im Rahmen der Projektarbeit praxisorientierte Empfehlungen abgeben zu können, wurden insbesondere dänische Erfahrungen herangezogen, da die kommunale Wärmeplanung dort schon seit den 1970er Jahren in die Stadtplanungsprozesse integriert ist. Um diese Erfahrungen auch in deutschen Kommunen nutzen zu können, wurde sich mit zentralen Akteur:innen der Wärmeversorgung in Dänemark ausgetauscht und verschiedene technische Anlagen besichtigt.
Die Forschungsergebnisse sollen den jeweiligen Stadtverwaltungen helfen, die kommunale Wärmeplanung in lokale Planungsprozesse einzubinden und effizient unter Beteiligung aller relevanten Akteur:innen umzusetzen. Dafür wurden aus den Ergebnissen der durchgeführten Wärmeplanung und der Exkursion nach Dänemark Handlungsempfehlungen abgeleitet, die sich an unterschiedliche Akteur:innen richten. Im Rahmen des Prozesses wurden konkret auf Neuenhaus und Bad Bentheim abgestimmte Handlungsempfehlungen abgeleitet, aber auch allgemeine Empfehlungen an Kommunalverwaltungen, Städtische Töchter, an den Bund, die Bundesländer und Regionen ausgesprochen.
Modulstruktur
| Lehrende | Bitte dem LSF entnehmen. |
| Teilnahmevoraussetzungen | Erfolgreiches Bestehen der Module 1, 2, 9 und 12. Es wird empfohlen das Modul im 5. und 6. Semester zu absolvieren. |
| Teilnahmebeschränkung | Für die Veranstaltung steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Zum Vergabeverfahren informiert Sie der Prüfungsausschuss. |
| Turnus und Dauer | Jährlich zum Wintersemester, 2 Semester |
| Aufwand | 720 Stunden, 24 LP |
| Prüfung | Abschlussbericht inkl. Disputation (benotet). Zulassungsvorrausetzung zur Modulprüfung ist das erfolgreiche Absolvieren der Prüfungsleistungen A und B. |